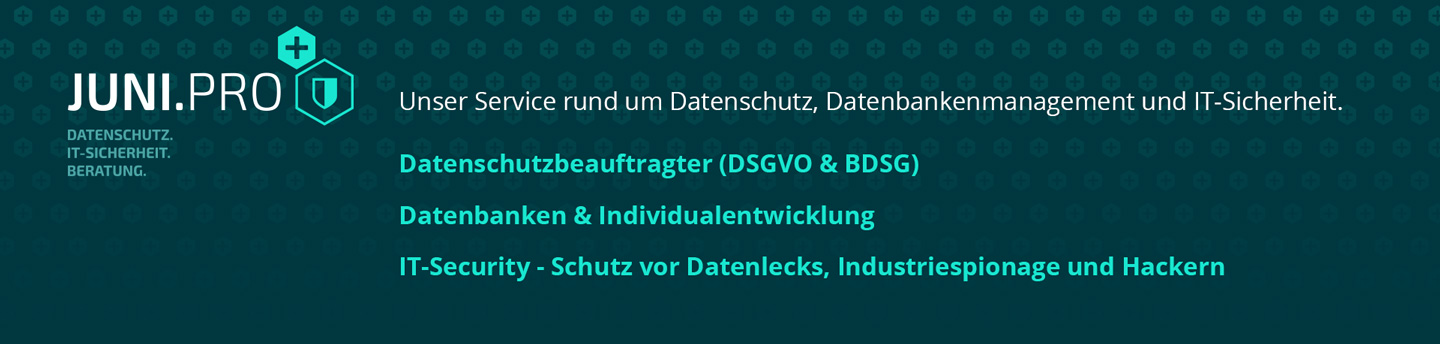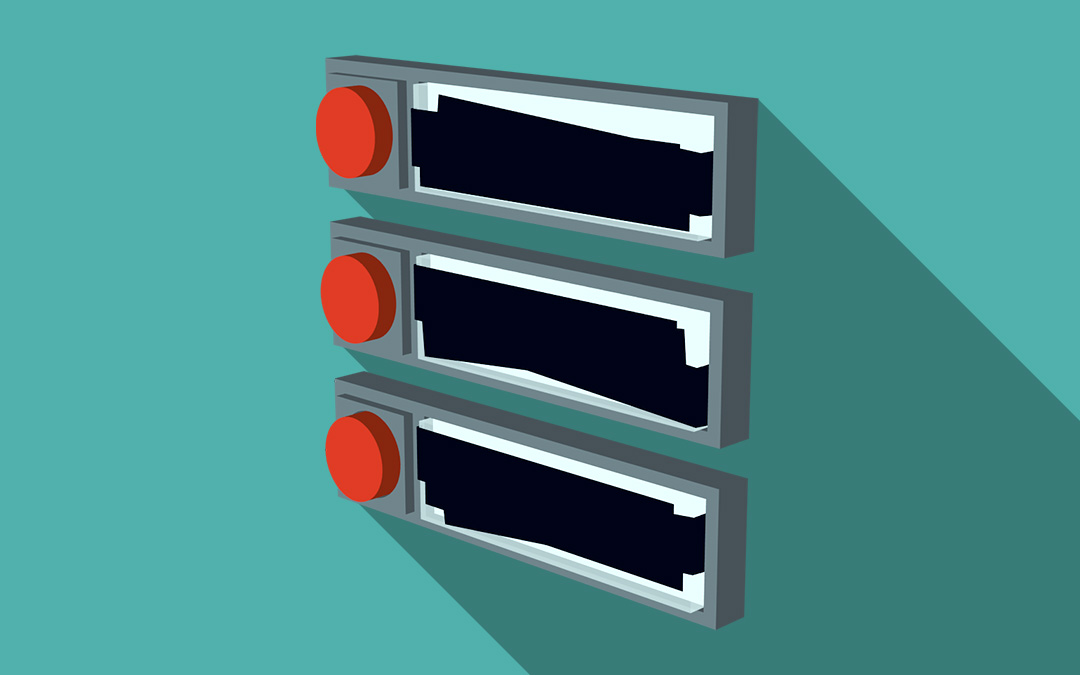Das Ende des freien Internets?
Das Ende des freien Internets? – Artikel 13 der EU-Urheberrechtsrichtlinie ist beschlossen
Es wird viel über die EU-Urheberrechtsrichtlinie diskutiert – niemand weiß was wirklich drin steht. Wir haben den besonders umstritten Artikel 13 unter die Lupe genommen und erklären hier, was er enthält und wo die Fallstricke liegen.
Wohl noch nie hat ein Gesetzgebungsverfahren die Netzgemeinde so bewegt wie der Gesetzgebungsprozess rund um die europäische Urheberrechtsrichtlinie. Mit einer Verspätung von zwei Monaten sind nun die Trilogverhandlungen zwischen der Europäischen Kommission, dem Rat der Europäischen Union und dem Europäischen Parlament beendet. Am 13. Februar 2019 wurde über die endgültige Fassung der Richtlinie abgestimmt. Über das Pro und Contra sowie die Positionen der Interessenvertreter berichteten wir bereits im Dezember.
Im April muss das EU-Parlament letztmalig über die Richtlinie abstimmen. Hier könnte sich nochmal etwas ändern, zumindest die Gegner der Richtlinie machen zur Zeit mobil, um auf diese letzte Abstimmung noch einmal einzuwirken.
Anschließend verbleiben den einzelnen Mitgliedstaaten zwei Jahre, um die in der Richtlinie gesetzen Regelungen in nationale Gesetze umzusetzen. Hierbei haben die Länder einigen Handlungsspielraum. Die Auswirkungen der Richtlinie im Detail sind daher noch nicht abschätzbar.
Wen betrifft Artikel 13 überhaupt?
Von der Richtlinie sind Anbieter von Diensten zur gemeinsamen Nutzung von Online-Inhalten betroffen, deren Hauptzweck darin besteht, dass von den Nutzern eine große Anzahl von urheberrechtlich geschützten Werke hochgeladen wird. Das sind Dienste wie Youtube oder Facebook.
Hier werden voraussichtlich viele Anbieter und Websites gar nicht erst von der Richtlinie betroffen sein, sofern der Hauptzweck nicht das Hochladen von Inhalten ist. Non-Profit Online Enzyklopädien (z.B Wikipedia), Non-Profit-Bibliotheken, Open-Source-Software, Online-Marktplätze und Business-to-Business-Cloud-Services sowie Cloud Services für den privaten Gebrauch sind direkt ausgenommen.
Start-Ups die diesen Hauptzweck erfüllen, sind war betroffen, werden aber privilegiert behandelt. Dazu unten mehr. Sicher betroffen sind Fotodatenbanken, kommerzielle Foren und soziale Netzwerke.
Die Haftung für illegale Inhalte wird auf den Dienstanbieter verschoben
Schon im Moment, in dem ein Nutzer einen Inhalt auf einer Plattform hochlädt, liegt eine öffentliche Zugänglichmachung durch den Dienst selbst vor. Das war bis jetzt umstritten und bisher vertrat der Europäische Gerichtshof eine andere Ansicht. Da der Nutzer das Hochladen veranlasse, sei auch nur der Nutzer für die öffentliche Zugänglichmachung verantwortlich, so das Argument des EUGH. Sollte der Inhalt bereits veröffentlicht worden sein, – also nur eine Kopie hochgeladen werden – lag nach dieser Auffassung auch keine öffentliche Zugänglichmachung durch den Nutzer vor. Die Dienstanbieter waren mit der bisherigen Rechtsprechung somit relativ sicher. Bisher musste der Dienstanbieter illegal auf der Plattform hochgeladene Inhalte erst löschen, wenn er Kenntnis von den illegalen Inhalten hatte. Dieser Streit wird in Zukunft durch Artikel 13 Absatz 1 entschieden. Die Verantwortung liegt fortan direkt beim Dienstanbieter.
Zukünftig sollen die Diensteanbieter Lizenzvereinbarungen mit Rechteinhabern treffen, um eine Genehmigung zur Veröffentlichung der Inhalte zu besitzen. Bisher musste jeder Nutzer, der fremde Inhalte verwendet, selbst Lizenzen von den Rechteinhabern erhalten. So zumindest in der Theorie. In der Praxis wurde dies wohl nur selten getan.
Die Lizenzvereinbarungen zwischen Dienstanbieter und Rechteinhabern sollen die Uploads von kleinen Nutzern, die keine nennenswerten Einnahmen mit ihre Tätigkeit auf der Plattform erzielen, abdecken. Der Hobby-Youtuber oder Micro-Influencer muss demnach dann keine eigenen Lizenzverträge abschließen, das übernimmt sozusagen die Plattform für ihn. Viele berühmte Youtuber, Podcaster oder Influencer benötigen weiterhin eigene Lizenzverträge, wenn sie fremde Inhalte nutzen. Das ist ohne den Artikel 13 auch jetzt schon notwendig.
In der Konsequenz wird man voraussichtlich nicht mehr gegen kleine Nutzer vorgehen können, die illegal Inhalte hochladen. Für die Inhalte der kleinen Nutzer ist die Plattform verantwortlich, die großen Nutzer müssen selbst Lizenzen einholen.
So kommen die Dienstanbieter aus der Haftung
Gibt es keine Genehmigung der Rechteinhaber haften die Plattformbetreiber. Wie diese Lizenzvereinbarungen in der Praxis geschlossen werden sollen ist unklar. Heutzutage ist praktisch jeder Mensch Rechteinhaber, weil er mit seinem Smartphone Bilder und Videos erstellt. Die Plattformen können unmöglich mit allen Menschen Lizenzvereinbarungen schließen. Auch stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Lizenzvereinbarungen getroffen werden müssen.
Die Haftung der Plattformbetreiber kann ausgeschlossen werden, wenn Sie nachweisen können, dass sie alle Anstrengungen unternommen haben, um eine Genehmigung des Rechteinhabers zu erhalten. Auch hier ist unklar, wie das in der Praxis umgesetzt werden soll.
Auch ist es möglich die Haftung auszuschließen, wenn der Plattformbetreiber alle Anstrengungen unternommen hat, um eine Veröffentlichung der nicht lizenzierten Inhalte zu verhindern. Hinter dieser Bedingung verstecken sich die vielfach kritisierten Upload-Filter, auch wenn die Richtlinie den Begriff nicht verwendet. Das von Youtube verwendete Content ID-Verfahren ist vergleichbar mit einem solchen Upload-Filter.
Hierfür müssen die Rechteinhaber alle ihre Inhalte der Plattform melden – auch die Inhalte, die nicht mit der Plattform lizenziert wurden, damit die Plattform überhaupt erkennen kann dass sie diese Inhalte gar nicht nutzen darf.
Die dritte Möglichkeit, um aus der Haftung zu kommen, besteht für die Plattformbetreiber darin, dass illegale Inhalte, die trotz allen Lizenzvereinbarungen und Upload-Filtern auf der Plattform gelandet sind, unverzüglich nach einer Mitteilung durch den Rechteinhaber zu löschen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass auch für die Zukunft sichergestellt wird, dass derselbe Rechtsverstoß nicht erneut vorkommt.
Wie umfangreich oder teuer diese Maßnahmen für die Plattformbetreiber sein müssen hängt davon ab, in welchem Verhältnis sie zu Größe und Reichweite der Plattform stehen. Eine kleine Plattform muss nicht die technische und rechtliche Infrastruktur auffahren wie beispielsweise Youtube.
Gänzlich ausgenommen von den Filtermechanismen sind, wie oben bereits angedeutet, Start-Ups, die nicht älter als 3 Jahre in der EU am Markt sind und die nicht mehr als 10 Millionen Euro Umsatz machen. Diese müssen sich lediglich bemühen, die nötigen Lizenzen abzuschließen.
Ab 5 Millionen Nutzern steigen die Anforderungen zur Abwendung von Rechtsverstößen. Nachdem ein illegaler Inhalt einmal auf der Plattform aufgetaucht ist, muss unterbunden werden, dass dies wieder geschieht. Diese Regelung ist nicht neu und wird heute schon vom Bundesgerichtshof gefordert.
Im Ergebnis ergeben sich einige Möglichkeiten für die Plattformbetreiber mit der veränderten Haftungslage umzugehen.
Karikaturen, Parodien, Zitate
Besonders kritisiert wurde, dass Karikaturen, Parodien und Zitate von den technischen Filtermechanismen nicht erkannt werden und somit ein unrechtmäßiger Eingriff in die Meinungsfreiheit entsteht. Bekannte Beispiele sind Memes, die Ausschnitte aus Spielfilmen in einem humorvollem Kontext darstellen. Die Richtlinie verlangt, dass Karikaturen, Parodien und Zitate weiterhin möglich sein müssen. Wie das sichergestellt werden soll, bleibt ebenfalls offen.
Weitere Anforderungen
Eine weitere Anforderung des Artikel 13 ist, dass sich aus der Anwendung der Richtlinie keine Überwachung der Nutzer ergeben darf oder Personen identifiziert werden können.
Weiterhin müssen wirksame und schnelle Beschwerdemöglichkeiten von den Plattformbetreibern bereitgehalten werden um Streitigkeiten zu klären. Streitigkeiten sollen auch außergerichtlich geklärt werden können. Hier müssen die nationalen Gesetzgeber eventuell entsprechende Rechtsbehelfe schaffen.
Wenn Inhalte wieder gelöscht werden sollen, weil Rechteinhaber dies fordern, muss dies mit einer menschlichen Überprüfung geschehen. Hierfür müssen die Dienstanbieter genügend Personal bereit halten.
Unklarheiten bei der Umsetzung
Die große Frage ist nach wie vor, wie,wann und mit wem Lizenzen abgeschlossen werden sollen. Dazu sagt die Richtlinie nichts. Das mag mit den großen Verlagen, Labels und Verwertungsgesellschaften relativ einfach sein. Hier können die Plattformbetreiber mit nur wenigen Verträgen viele Lizenzen abschließen. Im digitalen Zeitalter, in dem jeder Mensch ohne große Hürden Urheber ist, wird es spannend wie die Plattformbetreiber diese Lizenzpflichten in der Praxis umsetzen.
Neben all der unbegründeten Weltuntergangsstimmung rund im die Richtlinie ist dies wohl das größte Manko der Richtlinie: Sie verlangt hohe Anforderungen von den Plattformbetreibern, verschweigt aber gänzlich wie diese in der Praxis erreicht werden. Zumindest verspricht die Richtlinie schon jetzt, dass die EU-Kommission in Zusammenarbeit mit den Dienstanbietern, Rechteinhaber, Nutzerverbänden und Interessengruppen Leitlinien zur Umsetzung heraus gibt.
Für die Umsetzung in der Praxis werden die IT- und Rechtsabteilungen der Dienstanbieter jedoch einiges zu leisten haben. Zuerst sind die nationalen Gesetzgeber im Zugzwang aus den abstrakten Anforderungen der EU-Richtlinie konkrete Gesetze zu machen, die hoffentlich mehr Informationen zur Umsetzung enthalten.